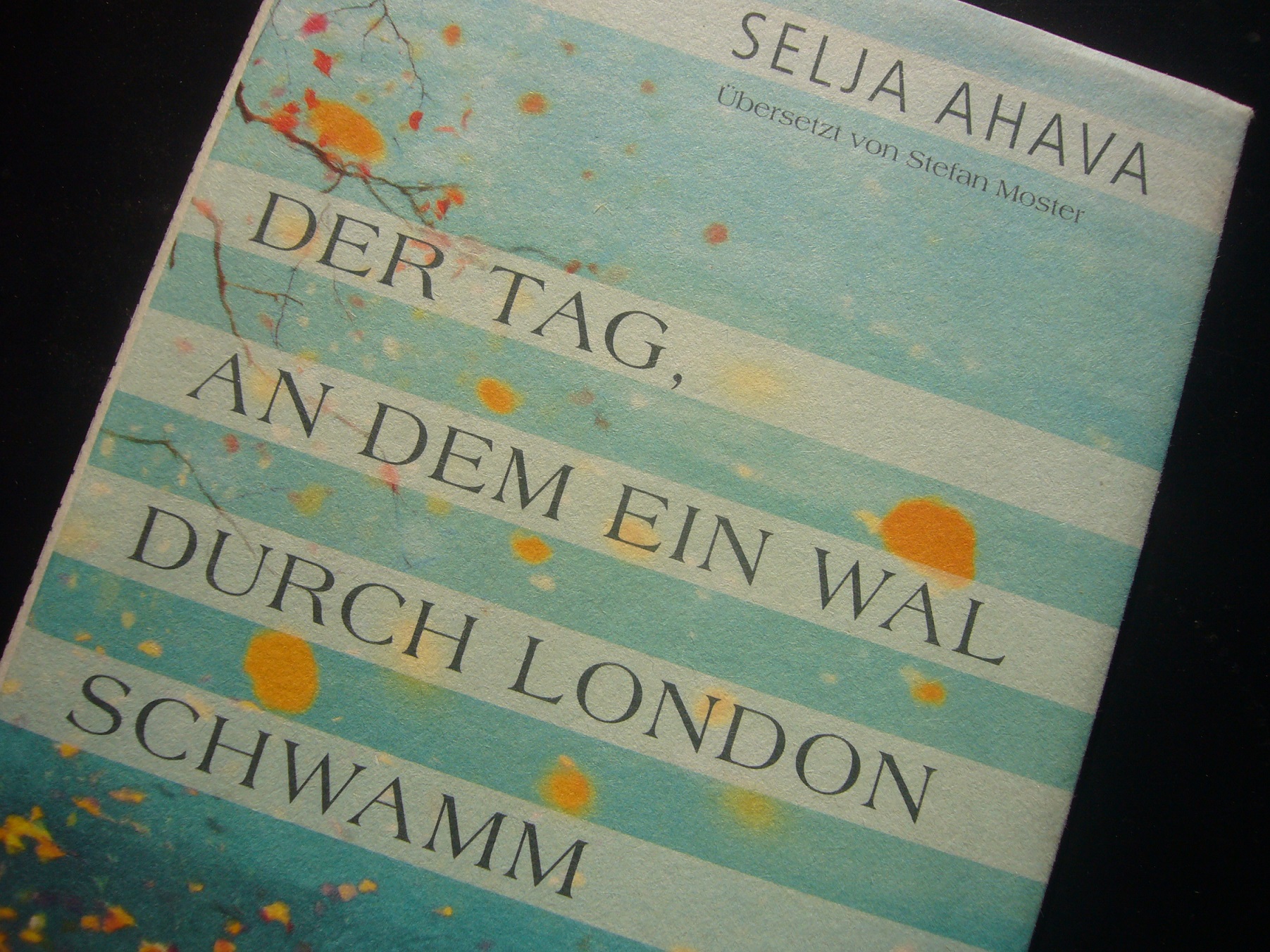Ein Gespräch mit dem Mediziner Dr. Johannes Wimmer über seine drei-Minuten-Videos, Sex trotz künstlichem Hüftgelenk und einen österreichischen Bergbauern.
Erstmal bin ich verwirrt: In der medizinischen Praxis sind Sie „Dr. Wimmer“, im Netz aber „Dr. Johannes“.Wie kommt’s?
Die Idee für „Dr. Johannes“ kam, weil das der Scherzbegriff ist, wenn Freunde, Bekannte oder Kollegen mal was brauchen. Die sagen dann nicht: „Dr. Wimmer“, die sagen auch nicht „Johannes“, die sagen „Dr. Johannes“. Mir gefällt das, denn es drückt die Nähe aus, die oft zwischen Arzt und Patient fehlt. So gesehen ist „Dr. Johannes“ für alle da und nicht nur für die Nachbarn, für die ich nachts zur Notapotheke fahre, weil die sagen: ‚Notaufnahme? Muss das sein?‘ Und so möchte ich sein, ich bin ja auch sehr ansprechbar über die sozialen Medien wie Twitter, Facebook, und als „Dr. Johannes“ stelle ich mich auch auf meinem Videoblogg vor. Bei der Anrede „Dr. Wimmer“ fühle ich mich wie auf einem Podest, so wahnsinnig weit weg. Und nur „Johannes“, das ist wiederum zu nah, denn es geht ja schon ums ärztliche, wenn mir jemand twittert.
Sie fahren für Ihre Nachbarn zur Notapotheke? Sie trennen nicht strikt Beruf und Privat?
Ich mache das, was ich tue so, weil ich auch als Privatperson so bin. Ich bin frei Schnauze und bin auch gerne für Leute da. Ich behandele ja andere Menschen so, wie ich selber behandelt werden möchte. Ich versuche allerdings die Familie rauszuhalten. Für meine Frau ist diese Öffentlichkeit, die ich suche, gar nichts. Aber unsere Dackel, die dürfen mit aufs Foto. Gestern war bei einer unserer Töchter eine Mandel-OP, da habe ich ein Foto gepostet, wie sie da liegt mit der Braunüle in der Hand, einfach um das zu zeigen und ich habe dazu auch geschrieben, wie ich mich gefühlt habe: Als Arzt und Papa ist man manchmal nur Papa. Und ich schreibe das auch, weil ich weiß, es kommt viel Nähe und Menschliches zurück.
Ärztliche Heilkunst und Internet, nicht jeder kriegt das zusammen. Wie geht’s?
Vorneweg: Die Patientenreise beginnt heute online. Es zwickt was – und man fragt Dr. Google, was das sein könnte. Und ganz typisch und menschlich: Die Menschen suchen mich nachts um drei. Die können mich ja auch tagsüber anrufen oder anschreiben. Aber sie sind dann unterwegs, wenn keiner da ist, wenn es mit der Ablenkung nicht mehr klappt, wenn die Ängste groß sind. Und dann freuen sie sich: Da spricht einer mit mir. Da ist einer da. Auch wenn es ein Video ist.
Wie sind Sie überhaupt zur Medizin gekommen?
Ach, ich hab mich erstmal nicht getraut. Weil ich dachte, ich bin zu doof. Ich hab mein Abitur mit Kunst- und Englischleistungskurs gerade so hingebogen, alle Naturwissenschaften hatte ich vorher abgewählt. Aber dieses Handwerk in der Medizin! Meine Mutter kommt von einem kleinen Bauernhof im Münsterland, alle aus der Familie sind Handwerker und dieser Lebensart des Anpackens, des Machens und auch mal etwas derbe sagen, dem fühlte ich mich immer sehr verbunden – und nicht der akademischen Welt. Ich hatte mich erst für Volkswirtschaft eingetragen und bin bei den Medizinern nur so mitgeschluppt. Bis mir einer von den Medizinstudenten sagte: ‚Das, was wir machen, kann auch ein Affe im Anzug. Du musst dich nur hinsetzen und ackern und lernen.‘ Das hab ich dann gemacht: hab‘ nächtelang Chemie durchgeackert. War überhaupt nicht meins – aber ich habe mir gesagt: Irgendwo ist das Licht. Das Licht am Ende des Tunnels! Chemie, Physik, Anatomie, Biochemie – das sind Werkzeuge, die muss man können. Und so sage ich das heute jungen Leuten: Ihr müsst das machen, was euch Spaß macht! Nur dann setzt ihr euch mal eine Nacht lang hin und oder büffelt eine Woche lang für irgendwelche Prüfungen.
Und was hat Sie dann ins Internet gezogen?
Das kam aus einer gewissen Not heraus. Ich habe in Hamburg jahrelang in verschiedenen Krankenhäusern und Praxen gearbeitet, unter anderem in einer kleinen radiologischen Stadtteilpraxis in Barmbek. Da kamen so richtige Barmbeker Typen, die auch mal über ihre Probleme sprechen wollten – aber ich merkte: Ich habe gar keine Zeit. Obwohl ich bei einem Radiologen gearbeitet habe, der sagte: ‚Ich schüttel jedem Patienten die Hand! Egal ob privat oder nicht.‘ Ich hab dann angefangen den Leuten schnell zu erklären, was ihr Problem ist, um ihnen dann zu sagen: ‚Wenn Sie zu Ihrem behandelden Arzt zurückgehen, stellen Sie ihm bitte diese und jene Frage.‘ Und irgendwann habe ich gemerkt: Ich erzähle ja immer das Gleiche. Was ich sage, ist für 90 Prozent aller meiner Patienten gültig. Idealerweise würde da ein Bildschirm hängen, wo all das schon mal erklärt wird. Und ich als Arzt bin dann für die zehn Prozent zuständig, die bei jedem unterschiedlich sind und habe genau dafür genug Zeit. Und diese medizinischen Grundlagen versuche ich in meinem Video-Blogg zu vermitteln, in drei-Minuten-Videos.
Und Sie sind gleichzeitig in der realen Welt als Arzt tätig?
Im Prinzip ja, im Moment nicht. Ich habe bis November in einer kleinen Hamburger Klinik gearbeitet, aber nun sind wir noch mal Eltern geworden, und ich mache gerade Elternzeit. Unsere Kleine ist jetzt fünf Monate alt und wenn es Richtung Kita geht, werde ich mir sicher neben meiner Internetpraxis wieder einen Job suchen, denn ich vermisse das jetzt schon. Meine Idealwoche sieht so aus: zwei, drei Tage in irgendeiner Klinik sein, aber tagesaktuell arbeiten. Vielleicht Radiologie, doch so wie ich es will und nicht irgendwo in einem Keller im Akkord die Röntgenbildern runterrocken. Oder Notfallmedizin. Notaufnahme ist überhaupt super!
Notaufnahme ist super?
Es ist wahnsinnig intensiv und unmittelbar. Sie erleben das menschliche Wesen pur. Ich bin in Südafrika in den Townships Notarzt gefahren, da war das einzige, was ich bei mir hatte, eine Sauerstoffflasche. Also, du fährst in ein Township, die Polizei biegt vorher ab, sagt nur: ‚Ihr fahrt da jetzt rechts weiter, wir nicht und viel Glück‘. Und dann kommst du in eine Wellblechhütte, da sitzen 30 Leute, in der Mitte das Familienoberhaupt, eine ältere Frau auf einer Art Thron und und vor ihr ein Mädchen, das hat gerade einen richtig schweren epileptischen Anfall. Und dann sagt man dir: ‚Die ist vom Tokoloshe besessen‘. Tokoloshe das ist so ein kleiner, zwergähnlicher Teufel, deswegen schlafen die Menschen in leicht erhöhten Betten, damit er sie nicht befallen kann. Ich wusste nur: Ich muss dieses Mädchen entstigmatisieren! Damit sie aus dem Krankenhaus zurück in die Familie kann; damit es nicht heißt: ‚Das ist eine Befallene!‘ Ich hab dann so getan, als hätte sie eine Verletzung und nicht einen Anfall; ich weiß gar nicht mehr, wie ich das hingekriegt habe! Jedenfalls, das ist dann richtig Medizin: Mit nix in der Hand die Situation akzeptieren, so wie sie ist – und handeln.
Überhaupt nicht so dramatisch, dafür recht lustig ist Ihr aktuelles Video zu Sex bei künstlichen Hüftgelenken. Was hat Sie zu diesem Thema geführt?
Mir tun die Menschen so leid! Es ist ein Scheißthema! Erst dürfen die Menschen nach der OP ewig nicht und wenn sie dann dürfen, dann dürfen sie nur in einer Stellung und zwar für immer. Und es spricht keiner mit ihnen drüber! Dann versuche ich doch lieber mit den Menschen darüber zu lachen, auch um ihnen zu vermitteln: Lieber eingeschränkter Sex mit künstlicher Hüfte, als gar kein Sex, weil die Hüfte so weh tut.
Sie sprechen in Ihren Videos durch die Kamera ja nicht nur zu den Patienten, sondern immer auch zu Ihren Kollegen …
Ich werde manchmal von Ärzteportalen wie DocCheck oder Medscape angefragt. Dann sage ich denen: Ich möchte nicht ein Video für den Arzt machen und danach eines für den Patienten, sondern wenn, dann muss es für beide sein. Der Gedanke ist ja: die Distanz verringern. Ich will das Ärzte und Patienten zusammenkommen. Dafür hüpfe ich sonstwo rum, sei es RTL-Explosiv oder auch im Tele-Shopping. Weil: Da ist die Frau in der Mark Brandenburg, ganz hinten links. Die hat nur ihren Fernseher. Mit der spricht keiner. Und wenn ich ihr etwas Medizinisches auf unterhaltsame Weise erklären kann, etwa, was ein grippaler Infekt und was eine Grippe ist, was spricht dagegen? Ich möchte lieber zehn Prozent Inhaltstiefe für 100 Prozent erklären, als 100 Prozent für zehn Prozent. Das muss man nicht gut finden, wird auch kontrovers diskutiert, aber das ist mein Weg. Mein Motto ist: Medizin ist Hausverstand! Deswegen muss es jeder verstehen und dann kann es auch jeder anwenden. Es bringt doch nichts, wenn ich einem Patienten mein Wissen auflade, der das aber nicht versteht, der hat ja nicht Medizin studiert. Es gibt Untersuchungen, dass Patienten nur ein Drittel des Gespräches mit ihrem Arzt verstehen. Ja, wie soll sie dann dessen Ratschläge umsetzen?
Ihre Videos sind von verblüffender Einfachheit ohne technischen Firlefanz: Sie sprechen in die Kamera wie zu einer Person. Und Sie gehen auch mal kurz aus dem Bild, um eine Skizze zu holen, kommen dann wieder, halten die ins Bild …
Ich nutze die Technik, aber ich mag sie nicht. Sie ist auch nicht wichtig. Mein Stativ hab ich zur standesamtlichen Hochzeit vor ein paar Jahren geschenkt gekriegt; als Kamera habe ich einen kleinen Camcorder, so ein 300-Euro-Ding, das man bei Ebay heute bestimmt für 40 Euro kriegt. Wichtiger ist: Ich lese nicht ab. Ablesen ist ein Albtraum, man kommt da so dröge rüber. Das Schlimme ist, wenn Sie die erste Male in eine Kamera sprechen, dann sprechen Sie wie ein Tagesschausprecher, ganz automatisch. Und das muss man sich abtrainieren. Dass ich so frei sprechen kann wie in dem Hüft-Video, das ist das erste mal ein Video, wo ich sage: Damit bin ich zufrieden. Da hatte ich einen guten Tag. Da war ich gelöst.
Ich muss gestehen, mich hat Ihr Video sehr berührt, wo es um das Überbringen von schlechten Nachrichten geht. Sie bekennen eben öffentlich, dass Sie auch manchmal Rotz und Wasser heulen, wenn vor Ihnen ein Patient sitzt, dem man nicht mehr wird helfen können …
Wir sollten uns als Mediziner nicht wegdrehen, wenn es vielleicht mehr um den Tod als um das Leben geht, auch wenn das viele Kollegen so machen. Wir müssen versuchen auch dann Worte zu finden, wenn es besonders schwer fällt. Ich hab ja später in Wien studiert, war dort in der Uniklinik tätig und zu uns kamen manchmal so richtig die Bergbauern. Ich erinnere, wir hatten einen Patienten, der hatte ganz schlechte Chancen, wo man sich fragen musste: OP – wollen wir die machen oder nicht? 25 Prozent Letalitätschance. Da muss der Patient schon sagen, ob er es machen will oder nicht. Aber der Mann konnte das nicht. Der war furchtbar durcheinander, der hat überhaupt nichts mehr gecheckt, so ist das manchmal und das geschieht nie aus bösem Willen. Und unser Chefarzt, schnicke angezogen, goldene Knöpfe am weißen Kittel, was hat der gemacht? Der hat den so richtig in Arm genommen und in breitem Österreichisch gesagt: ‚Geh, Hubert, hörst‘: Was wir machen, ist ne harte Geschicht‘; schafft nur einer aus vieren, aber bei dir packen wir’s! Solln wir’s machen?‘
Und?
‚Ja, machen wir‘, hat der Hubert gesagt. Und so muss es sein.
Dr. Johannes Wimmer betreibt das Internetportal www.doktor-johannes.de
Erschienen in Taz Nord vom 19.4.2014