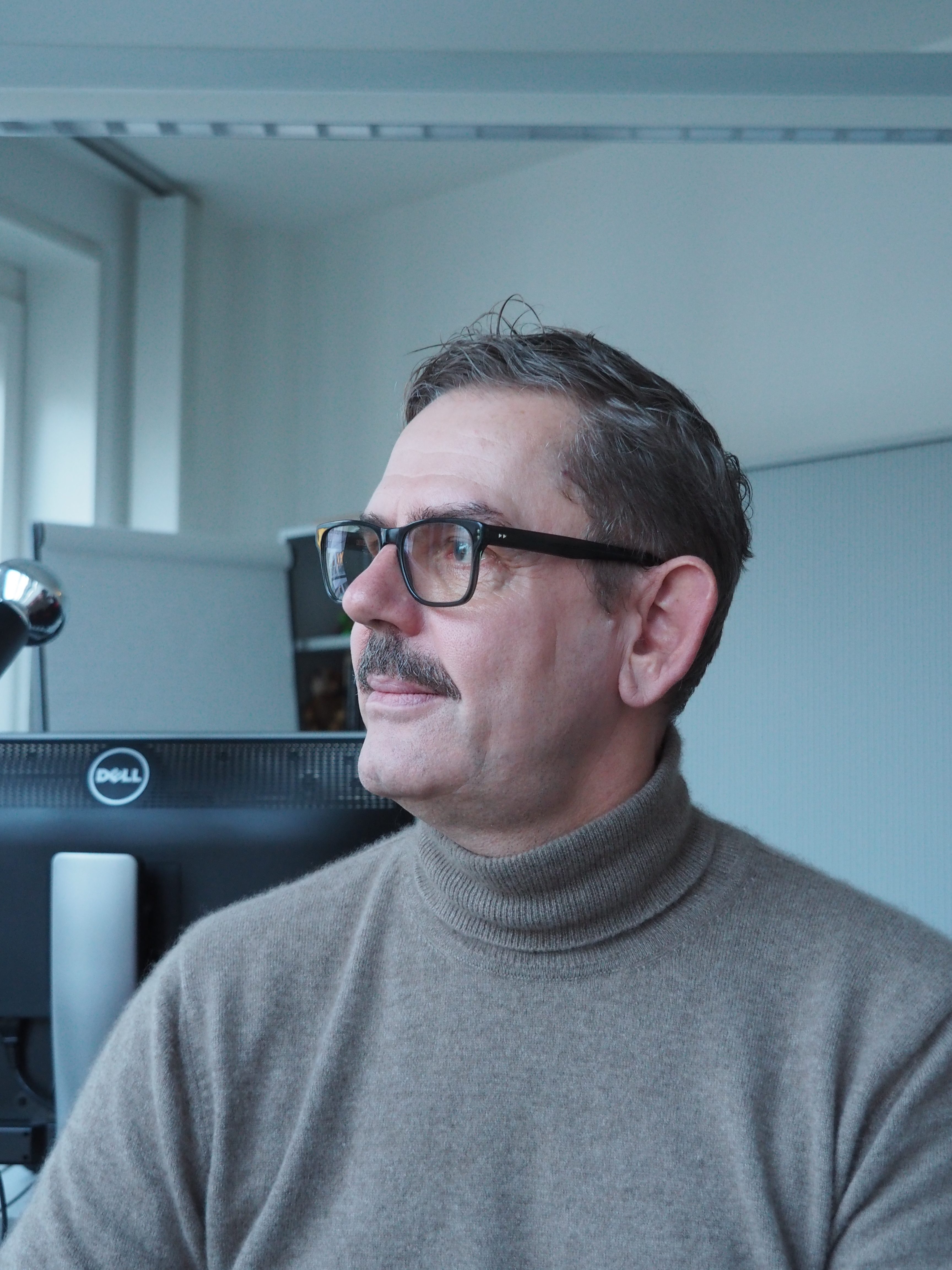Von inneren Motiven, ein Studium lieber nicht zu beenden, von vor Prokrastination gefeiten Medizinstudenten und einer aufgeräumten Küche – ein Gespräch mit Ronald Hoffmann, Leiter der „Zentrale Studienberatung und Psychologische Beratung“ der Universität Hamburg.
Ein Beitrag für das Prokrastinations-Heft des Männermagazins ERNST. Nummer 1/2019.
Foto: Frank Keil
Wenn man über Prokrastination spricht, was ist das größte Missverständnis?
Es gibt zwei große Missverständnisse: das ist etwas ganz Schlimmes. Und: Prokrastinierer sind faul. Beides stimmt nicht.
Sondern?
Prokrastinieren tun wir alle. Jeder von uns kennt Zeiten des Prokrastinierens, weil es etwas sehr Menschliches ist. Und das mit dem faul-sein stimmt nicht, weil die Zeit des Prokrastinierens sehr konstruktiv gefüllt wird – nur nicht mit dem, was man eigentlich tuen sollte. Aber das heißt nicht, dass man nichts tut. Man ist hochgradig aktiv und macht in der Regel sehr sinnvolle Dinge. Man sollte sehr genau schauen, wenn man über Prokrastinieren spricht – und bedenken, dass es erstmal ein sehr alltäglicher Vorgang ist.
Ab wann wird es kritisch?
Es wird kritisch, wenn man entweder anfängt selber darunter zu leiden. Also: Ich bemerke immer wieder, dass ich bestimmte Aufgaben nicht erledigt bekomme. Oder wenn es anfängt einem selbst zu schaden. Ganz schlicht: Wenn man das Bezahlen einer Rechnung prokrastiniert, einfach weil man es aufschiebt und nicht, weil man gerade kein Geld hat, und muss dann Mahngebühren bezahlen, dann richtet es sich gegen einen selbst. Wenn man – ich greife jetzt ein bisschen vor – die Abgabe einer wichtigen Arbeit während des Studiums prokrastiniert, dann kann man – und das tun wir hier in unserer Arbeit – durchaus hinterfragen, ob das vielleicht einen nicht unmittelbar zugänglichen Sinn erfüllt für die Person, die das tut. Also: Gibt es vielleicht verborgene Motive, warum das Studium gar nicht beendet werden will? Und ist es also vielleicht sogar äußerst sinnvoll, in der inneren Logik einer Person, ein Studium gerade jetzt nicht zu beenden?
Da treffen dann zwei Welten aufeinander: die Universität, die einen zeitlich klaren Abschluss einfordert und eine Person, die ganz wo anders ist?
Die Universität sagt: Bitte möglichst schnell, möglichst erfolgreich und möglichst glücklich ein Studium absolvieren. Das ist etwas, was wir unterstützen: Wir wollen, dass die Studierenden ihr Studium möglichst zügig beenden und dabei möglichst zufrieden und glücklich das Studium auch durchlaufen können. Es kann nun innere Motive eines Studierenden geben, die einem von außen gar nicht zugänglich sind – das wird dann Teil einer Beratung oder eventuell einer Therapie, die wir hier allerdings nicht machen, da verweisen wir dann an entsprechende Stellen. Also: Es kann Motive geben das Studium nicht zu beenden, die in der eigenen Person ihren Sinn machen.
Was könnte das für ein Motiv sein?
Klassisches Beispiel: Ich bin der erste aus einer Familie, der eine Hochschulzugangsberechtigung hat. Und ich bin der erste, der ein Studium beginnt. Alle anderen in der Familie haben das nicht. Dann bedeutet unter Umständen das Ende des Studiums die Besiegelung einer noch größeren Grenze zwischen mir und meiner Familie. Das kann in einem jungen Menschen durchaus eine Besorgtheit auslösen; eine Angst, dann nicht mehr Teil dieser Familie zu sein. Weil man nun offensichtlich so anders ist, als die anderen. In der Realität wird das meistens nicht passieren: Die meisten Familien sind pur stolz, wenn der erste das Studium beendet und auch noch gut durchgekommen ist. Aber diese innere Sorge kann ein Motiv sein, dass ich, ohne dass es ich es mir bewusst mache, erst mal einiges dafür tue, dass ich das Studium nicht beende. Und noch ein bisschen bleibe – in diesem ‚armer Student-Status‘. Bevor ich dann doch in eine Firma einsteige und dort – denn so ist das Studium angelegt – eine Leitungsfunktion übernehme und dann einer von denen werde, über die man zuhause bei Tisch lacht und über die immer geschimpft wurde. Wie sitze ich denn nun am Tisch?
Familien senden ja oft Doppelbotschaften aus …
‚Super, mach‘ alles, dass du erfolgreich bist – aber entferne dich auf keinen Fall zu weit aus der Familie‘. Das ist – etwas anderes Thema – ein ganz typisches Migrationsthema. ‚Wir möchten, dass du hier ganz erfolgreich bist, aber werde bitte nicht zu deutsch‘. Das sind Aufträge, die die Kinder bekommen, die sie gar nicht erfüllen können, weil sie sich widersprechen.
Sie beraten nun, das heißt: Sie sondieren erst mal die Lage?
Wir machen Einzel- und Gruppenberatung. Für das Thema ‚Prokrastination‘ haben wir eine Gruppe, die sehr regelmäßig läuft. Sie nennt sich ADA: anfangen – dranbleiben – abhaken. Dabei spielt der soziale Kontrollaspekt einer Gruppe durchaus eine Rolle, weil man sich regelmäßig trifft und sich auch berichtet, wie der eigene Stand im Hinblick auf die Fortschritte bei der Studienleistung ist. In der Einzelberatung bieten wir bis zu fünf, sechs Termine an – und die sind in der Regel dafür da, einmal zu schauen, woran liegt es. Also: Wenn wir im Gespräch auf die Spur kommen, hier gibt es unbewusste Anteile des Prokrastinierens, dann würden wir weiterverweisen in Richtung einer Therapie. In der Regel reichen diese Termine.
Gibt es sozusagen unterschiedliche Schweregrade beim Prokrastinieren?
Beim Prokrastinieren hängt es davon ab, ob es eine sehr eingeübte Haltung ist, die sich vielleicht schon seit längerem durchs Leben zieht und sich verfestigt hat; oder ist es die erste Hausarbeit, die Schwierigkeiten bereitet oder ist es eine besonders schwierige Hausarbeit, vielleicht in einem Nebenfach, das auch nicht mein Hauptinteresse hat. Hauptgründe für das Prokrastinieren sind: ‚Ich finde es langweilig, es interessiert mich nicht‘, und dann ist es schon schwierig mit so einer Arbeit anzufangen. Oder es ist so kompliziert, so neu, da habe ich gar keinen Faden, an dem ich mal ziehen kann, so dass ich weiß, was ich überhaupt tuen muss.
Gibt es Häufungen? Trifft es eher junge Männer als junge Frauen? Gibt es eine soziale Gewichtung?
Ich beobachte so etwas nicht. Das ist eine gefühlte Statistik: Es ist etwas, was wir alle tuen. Es gibt sicherlich unterschiedliche Lerntypen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne – aber ich schaue mal auf die Medizinstudierenden. Die sind in der Regel sehr leistungsfähige Schüler und Schülerinnen gewesen; die einen Lernstil für sich entwickelt haben, mit dem sie sehr erfolgreich sind. Die Wissen punktgenau abrufen können, um entsprechend gute Leistungen in der Schule zu erbringen, damit ein gutes Abitur und dann einen Medizinstudienplatz erreicht haben. Die schreiben nun keine Hausarbeiten im klassischen Sinne, die schreiben Klausuren, die haben Testate – und müssen unglaublich viel lernen. Da entspricht sozusagen die Prüfungsform auch sehr genau der Struktur der Person, die in dieses Studium hereinkommen. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Medizinstudierenden beraten, der sagte: ‚Eigentlich müsste ich lernen, aber ich fange nicht an‘. Das machen die einfach – die lernen.
Sie erfüllen also die Grundbedingung gut durch so ein Studium zu kommen?
Richtig. Mein Lieblings-Studi-Witz lautet: Ein Philosophie-Student, ein Jura-Student und ein Medizin-Student bekommen die Aufgabe das Telefonbuch auswendig zu lernen. Der Philosophie-Student fragt: ‚Warum soll ich das tun?‘, der Jura-Student fragt, ob das denn prüfungsrelevant ist, und der Medizin-Student fragt: ‚Bis wann?‘. Ansonsten würde ich keinen Studiengang ausmachen, wo ich sagen würde: Die sind davor gefeit, zu prokrastinieren.
Wie ist das bei kreativen Studienfächern?
Wir bedienen ja auch die Kunsthochschulen, auch da habe ich keine Anmeldungen im Kopf. Wobei es hier eher um kreative Blockaden gehen könnte, die die Studierenden belasten; das Gefühl, nicht im Fluss zu sein, es geht weniger um das prokrastinieren, weil Kunststudierende ja viel mehr als Studierende in den Natur- oder Wirtschaftswissenschaften aufgefordert sind, Dinge aus sich heraus zu entwickeln. An den sonstigen Universitäten wird ja wissenschaftliche Methodik und Denken vermittelt, das ist also auch eine Art Handwerk, das man erlernt. Was mir einfällt: Ich hatte einmal einen jungen Mann aus der Musikhochschule, der sich hier hinsetzte und die Beratung begann mit dem Satz ‚Ich liebe meine Gitarre nicht mehr. Und sie liebt mich auch nicht‘.
Okay …
Hier ging es nicht um die Prokrastination des Übens, sondern: ‚Ich bin mit meinem auch emotionalen Erleben meines Spiels auf dem Instrument nicht mehr im reinen‘. Da ging es eher um eine Sinnkrise: Ist das wirklich sinnvoll, was mache ich mit Gitarre, immer diese Wettbewerbe, zu denen ich geschickt werde – es ging um diesen Druck, ständig produzieren zu müssen.
Bei Literaten gibt es ja den fast gepflegten Begriff der Schreibhemmung …
Ich kenne das aus meiner Diplom-Arbeit: Ich wohnte damals in einer WG, die Küche war nie so aufgeräumt, wie in der Zeit, als ich meine Arbeit schreiben musste. Ich habe gekocht, und ich habe eingekauft, ich habe gemäß dem Klischee prokrastiniert. Ich habe die Arbeit dann trotzdem in der Zeit geschafft, am Ende. Aber – das hat ein bisschen gedauert.
Ich prokrastiniere, was hilft jetzt?
Es hilft sich klarzumachen, dass man es tut. Und es hilft auch sich klarzumachen, warum tue ich es. Es können Motive sein, die wir eingangs besprochen haben, in der Regel sind das aber eher Motive wie ‚ich habe keine Lust‘ oder ‚ich finde es langweilig‘ oder ‚es überfordert mich‘. Ich bin vielleicht müde, ich bin ablenkbar, ich habe grad ganz andere Sorgen – vielleicht habe ich mich gerade von meiner Freundin oder meinem Freund getrennt. Also: sich selbst klarzumachen, was los ist. Und dass – und das machen wir hier – mit jemanden besprechen, der das ein Stück weit moderiert: ‚Was geht in mir vor, wenn ich prokrastiniere?‘ In der Hoffnung, dass wir herauskriegen, was könnte der Hintergrund sein. Und wenn ich da eine Idee habe, wäre das der erste Anknüpfungspunkt einen Plan zu machen, der aber die Hürde, die gerade für mich da ist, mit einbezieht.
Was könnte das für eine Hürde sein?
Wenn ich feststelle, ich bin oft müde – dann müsste ich schauen, ob ich denn in meinem Tagesablauf die idealen Zeiten einplane. Gehe ich rechtzeitig ins Bett, stehe ich entsprechend auf? Habe ich die richtigen Zeiten für meinen individuellen Bio-Rhythmus gewählt, um gut arbeiten zu können? Ganz viele Menschen nehmen sich vor ‚ich setze mich morgens hin und lege los‘, aber erst mal checken sie noch schnell ihre Mails. Das ist in der Regel falsch. In der Regel sollte man sich in intensiven Arbeitsphasen morgens hinsetzen und anfangen zu arbeiten. Mails lesen und die Sozialen Medien abklappern und Spiegel-Online lesen, das kann man sehr gut nach der Mittagspause tuen, wenn bei ganz vielen Menschen der Bio-Rhythmus in den Keller geht, denn dafür brauche ich nicht die volle Aufmerksamkeit.
Und dann sitze ich da – und irgendwas kommt dazwischen …
Wenn ich sage, ‚ich werde immer abgelenkt‘, kann ich schauen, ob es vielleicht bessere Orte zum Arbeiten gibt, etwa eine Bibliothek. Etwa, wenn jemand in einer WG wohnt, einem Studentenwohnheim – da ist immer was los. Oder das Handy macht immer ‚Pling!‘, das ist relativ verbreitet. Dann wirklich auf die Idee zu kommen, ich tue das Handy in einen anderen Raum oder ich schalte es mal ganz aus, zwischendurch, darauf kommen überraschenderweise die wenigsten. Also: Man kann eine individuelle Strategie entwickeln, wenn man eine Idee bekommt, woran es liegt.
Brauche ich vielleicht eine eigene Haltung für die Zeit, wo ich sehr konzentriert etwas Unaufschiebbares erledigen muss?
Ich muss mich von dem Gedanken verabschieden, dass Prüfungszeiten angenehm sind. Dass ich also entspannt und immer lächelnd eine Master- oder Bachelor-Arbeit schreibe – das ist nicht so. Das sind Zeiten, die in der Regel belastend sind; die stressig sind. Da sollte ich mir keine Illusionen machen, dass es da einen Kniff gibt und wenn ich den nur rauskriege, dann ist das alles ein einziger Spaziergang. Ist es nicht, wird es in der Regel auch nicht. Also: realistisch bleiben in den Anforderungen an sich selbst und nicht ‚ich muss immer locker-flockig bleiben‘. Oder ähnlich fatal: ‚Ich muss acht Stunden am Tag produktiv sein‘ – das kann ich nicht, das schafft keiner. So kommen wir mit Studierenden ins Gespräch: dass sie freie Tage einplanen. Oder dass ich einen Tag, an dem ich viel schaffen wollte, aber nichts geschafft habe, diesen nicht als eine große Niederlage bewerte, sondern eher einkalkuliere, dass ich einen Tag nicht offensichtlich produktiv war, aber trotzdem etwas passiert ist. Solche Tage sind Teil eines Prozesses – wenn ich dann am nächsten Tag wieder einsteige!
Wie ist es, wenn man zu hohe Erwartungen an sich selbst hat?
Wenn ich nicht verstehe, dass eine Hausarbeit in einem Fach eine Übung ist, eine Übung für mich, wo ich wissenschaftliches Arbeiten überhaupt erlerne, sondern wenn ich denke, ich muss in meiner dritten Hausarbeit etwas schreiben, dass in zehn Jahren den Nobelpreis bekommen wird, dann habe ich ein Problem, dann funktioniert das nicht. Ich hatte hier mal jemanden – auch weil ich vorhin sagte: ‚Dann mache ich einen Plan‘ – der hatte seine ganze Zeit damit zugebracht, den perfekten Plan zu entwickeln. Er ist über das Planen nicht in das Arbeiten gekommen. Mit anderen Worten: Immer, wenn ich versuche zu perfekt zu sein, wird mir das früher oder später ein Bein stellen.
Außer dem Interview mit Ihnen wird es ein Gespräch mit der Publizistin Kathrin Passig geben, die dafür plädiert, mehr Mut zu haben ‚halbfertig‘ zu sein …
Ja! Mut zur Lücke! Ganz richtig. Was ich so spannend an dem Thema finde: dass es uns alles betrifft! Stellen Sie sich in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis jemanden vor, der nie prokrastiniert; der jede Arbeit sofort und absolut erledigt. Das wäre – relativ schwierig. Da bleibt wenig Raum für Spontanität, für Kreativität. Für – wie Freud sagte – läppisch sein. Denn, das wissen Sie ja – die Arbeit endet nie. Ich habe immer eine Liste auf dem Schreibtisch liegen, mit Dingen, die ich noch erledigen muss. Wenn ich hier erst rausgehen würde, wenn ich alles abgearbeitet habe …
… würden Sie hier nie rauskommen …
Ja, und das wäre auch ein unvollständiges Leben.
Zum Abschluss: Ich bin auf dem Weg hierher an einer Werbetafel vorbeigekommen, auf der stand ‚Früher hatte ich Elan, heute habe ich Wlan‘. Wie weit fördern die Neuen Medien eine Ablenkungskultur?
Ich weiß es nicht genau. Es gibt Studien, die herausgefunden haben wollen, dass die Aufmerksamkeitsspanne junger Menschen drastischer zurückgegangen ist. Es gibt im Zusammenhang mit Computersucht das Thema einer direkten Bedürfnisbefriedigung – weil ich auf meine Aktion sofort eine Reaktion erfahre. Das ist natürlich etwas, was in krassem Widerspruch steht zu einer wissenschaftlichen Hausarbeit. Denn da sitze ich über mehrere Tage, wenn nicht Wochen, ohne dass ich irgendein Feedback bekomme. Das ist in den Sozialen Medien krass anders: Da poste ich etwas und kann, wenn ich witzig bin und gut schreiben kann, im Minutentakt Likes sammeln und ablesen. Eine Hausarbeit ist dagegen sehr zeitverzögert – insofern spielt das sicherlich eine Rolle. Gleichzeitig tue ich mich immer schwer mit der These, die Sozialen Medien bringen das große Unglück über uns. Ich mache die Erfahrung, die Mehrheit der Studierenden können die Risiken, aber auch Chancen der Neuen Medien durchaus einordnen und damit umgehen. Von daher weiß ich auch nicht, ob Prokrastination – wie oft behauptet wird – heute zugenommen hat. Wenn ich mir meine Küche aus den 1980er-Jahren anschaue, also da haben wir damals auf ähnliche Weise die Dinge vor uns hergeschoben.